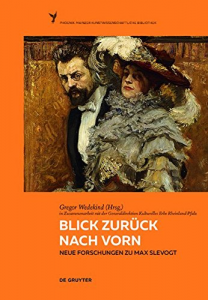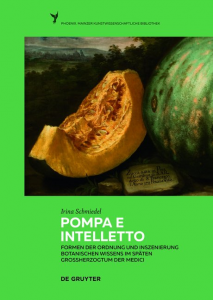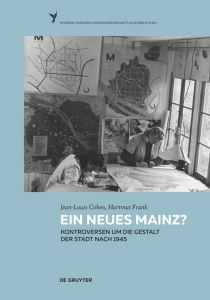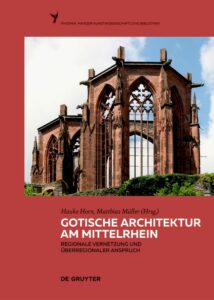Die Buchreihe Phoenix. Mainzer kunstwissenschaftliche Bibliothek dient der Abteilung Kunstgeschichte in Mainz und ihrem wissenschaftlichen Umfeld als Publikationsorgan und beinhaltet herausragende Monographien und Sammelbände. Die Phoenix-Reihe wird von Prof. Dr. Matthias Müller, Prof. Dr. Elisabeth Oy-Marra und Prof. Dr. Gregor Wedekind herausgegeben und die einzelnen Bände erscheinen im Verlag Walter de Gruyter (Berlin/Boston). Benannt ist die Reihe nach jenem Bronzerelief des Phoenix von Emy Roeder, das 1960 in programmatischer Absicht für den Eingang des damals neuen, anstelle einer Kriegsruine errichteten Institutsgebäudes angefertigt wurde. Heute ziert das Relief den Eingangsbereich der Abteilung Kunstgeschichte im Georg Forster-Gebäude auf dem Universitätscampus in Mainz.
Band 1: Die Farbe Grau
Hrsg. v. Magdalena Bushart und Gregor Wedekind (Erscheinungsdatum: April 2016)
Publikation anlässlich der gleichnamigen Tagung, die das Institut für Kunstgeschichte Mainz (Prof. Dr. Gregor Wedekind) in Kooperation mit dem Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik der Technischen Universität Berlin (Prof. Dr. Magdalena Bushart) vom 18. bis 20. April 2013 in Mainz ausgerichtet hat.
Band 2: Blick zurück nach vorn. Neue Forschungen zu Max Slevogt
Hrsg. v. Gregor Wedekind in Verbindung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesmuseum Mainz (Erscheinungsdatum: Oktober 2016)
Publikation anlässlich eines wissenschaftlichen Kolloquiums, das im Zusammenhang der Ausstellung „Max Slevogt – Neue Wege des Impressionismus“ im Landesmuseum Mainz am 16. und 17. September 2014 stattfand.
Autorin: Dr. Irina Schmiedel (Erscheinungsdatum: September 2016)
Publikation der 2014 eingereichten und von Prof. Dr. Elisabeth Oy-Marra und Prof. Dr. Volker Remmert (Wuppertal) betreuten Dissertation.
Band 4: Mainz nach 1945: Die Stadtplanung von Marcel Lods
Hrsg. v. Jean-Louis Cohen und Hartmut Frank (Erscheinungsdatum: März 2017)
Die Publikation stellt die jahrelange Forschung der beiden Autoren zur Mainzer Stadtgeschichte vor. Kurz nach 1945 sollte die großflächig zerstörte Stadt unter dem Architekten Marcel Lods neu aufgebaut werden. Sein Projekt wurde jedoch nie umgesetzt. Band 4 der Phoenix-Reihe bietet nun erstmalig eine systematische Aufarbeitung dieser Planung.
Band 5: Gotische Architektur am Mittelrhein. Regionale Vernetzung und überregionaler Anspruch
Hrsg. v. Hauke Horn und Matthias Müller (Erscheinungsdatum: 2020)
Der Mittelrhein weist nicht nur eine reizvolle Landschaft auf, sondern auch eine außergewöhnliche Dichte an anspruchsvollen mittelalterlichen Kirchenbauten und Burgen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Funktion des Rheins und seiner Nebenarme als europäisches Verkehrsnetz im Mittelalter, das zahlreiche wichtige Metropolen und Städte miteinander verband. Durch den Handel entstanden Netzwerke und Transferprozesse, aber auch Konkurrenzen und Konflikte um die Kontrolle über das geostrategisch wichtige Engtal. Vor diesem Hintergrund beleuchten die Autoren des Bandes die gotische Architektur des Mittelrheins aus kulturwissenschaftlicher Perspektive.
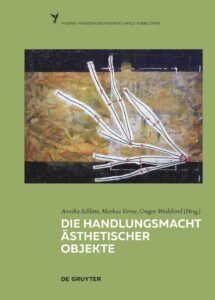
Band 7: Die Handlungsmacht ästhetischer Objekte
Hrsg. v. Annika Schlitte, Markus Verne und Gregor Wedekind (Erscheinungsdatum: 2021)
Ästhetische Erfahrungen sind ohne spezifische Objekte grundsätzlich nicht zu denken. Welche Folgen hat diese Objektbezogenheit für das Wesen ästhetischer Erfahrung? Inwieweit bestimmen ästhetische Objekte die Art ihrer Erfahrung mit und damit auch ihre reflexiven und praktischen Folgen? Die Beiträge des Bandes verfolgen ihr Thema einerseits empirisch, durch die Untersuchung konkreter ästhetischer Objekte aus Kunst, Populärkultur und Religion, zum anderen aber auch durch fachhistorische und theoretische Reflexionen. In Auseinandersetzung mit theoretischen Neujustierungen wie Posthumanismus, Akteur-Netzwerk-Theorie, objekt-orientierter relationaler Ontologie, spekulativem Realismus werden die herkömmlichen sozialkonstruktivistischen Erklärungsmodelle überwunden zugunsten einer Bestimmung des Ästhetischen als notwendiges Wechselspiel aus Objekt und Erfahrung, bei dem beides eng aufeinander bezogen ist, ohne dass aber das eine im jeweils anderen tatsächlich auch aufginge.
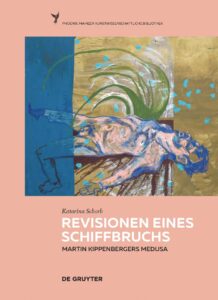
Band 8: Revisionen eines Schiffbruchs - Martin Kippenbergers Medusa
Autorin: Katarina Schorb (Erscheinungsdatum: 2021)
Martin Kippenberger (1953 – 1997) zählt zu den herausragenden Künstlern der 1980er und 1990er Jahre. Ein Jahr vor seinem Tod entstand Medusa, einer der größten zusammenhängenden Werkkomplexe des Künstlers. In über 80 Werken setzt er sich darin mit Theodore Géricaults Ereignisbild Das Floß der Medusa (1819) auseinander. In dieser historisch-kritischen Analyse wird der Werkkomplex erstmals im Gesamtwerk kontextualisiert, seine Entstehungsgeschichte umfassend nachvollzogen und Kippenbergers Rezeption von Géricaults Salonbild genau untersucht. Medusa weist weitaus komplexere Dimensionen auf, als lediglich die Metaphorisierung der persönlichen Situation des Künstlers. Kippenberger übersetzt Géricaults Gemälde in die Gegenwart und schafft so Revisionen eines Schiffbruchs.